|
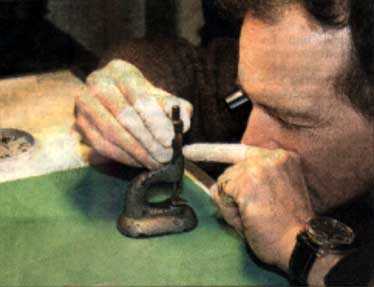

|
18000 Halbschwingungen pro Stunde, Handaufzug,
Ankerhemmung, „robust und zuverlässig", preist unser Seminarleiter das
kollektive Konstruktionsgeschick sowjetischer „Helden der Arbeit". Und
findet einen Vergleich, der die anfängliche Skepsis seiner Zuhörer zu
zerstreuen vermag: „Wie die MIR." Man lächelt sich kurz zu in der Runde,
bleibt aber ansonsten konzentriert und ernst. Einer heißt sogar so. Ein
Schweizer, er leitet in St. Gallen ein Unternehmen, das Präzision„,;-Messinstrumente
herstellt. „Das isckA nicht meini ärsc,hdi Sälbschdg'machdi", sagt er mir
später, als man sich beim Kaffee gegenseitig seine Armbanduhren zeigt. Er
bringt sogar sein eigenes Werkzeug mit hierher, in einer Art Pilotenkoffer,
sehr professionell.
|
|
Auch meine anderen sechs UhrenbastlerKollegen,
die den Kurs bei Till Lottermann, seinem Partner Franz Wolff und dem Mannheimer
Uhrenfan Thomas Henne gebucht haben, erweisen sich rein theoretisch als echte
Durchblieker und Richtig-Ticker. Hemmungen, Spannungen, Triebe - nichts
Mechanisches scheint ihnen fremd. Den Part des Laien muss dann wohl oder übel
ich übernehmen, eine Rolle, die ich mit einem - zugegeben, leicht kindischen -
Witzchen auflockern will. Mein „man glaubt ja gar nicht, was da alles an Schräubchen,
Rädchen und Federchen rein passt in so `ne kleine Uhr", erntet indes nur
mitleidiges Lächeln - oder Blicke, die mir das Gefühl vermitteln, ich müsse mir
nun sofort und unbedingt den Mund mit Seife auswaschen.
|
|
Sei's drum, nach anderthalb Stunden, in denen wir
uns mit den Innereien der Zeitmessung beschäftigen, kann sogar ich mitreden.
Uhrmacher sind geduldige und feinfühlige Menschen. Till und Franz schauen jedes
Mal, wenn sie Fragen wie„ So, habt ihr's alle verstanden?" stellen,
besonders lange und intensiv in meine Richtung. Ich nicke - und das ist fast
gär nicht geschwindelt.
Nach dem Mittagessen dann die Stunden der
Wahrheit: Till legt unsere Uhren auf den Tisch: „Eure Namen auf dem Zifferblatt
müsst Ihr euch aber erst verdienen:" Zweimal sollen wir bis morgen Abend
jedes einzelne Teil - und so eine Uhr hat, wie bereits gescherzt,, davon
unglaublich viele - aus- und wieder einbauen. „Dazwischen veredeln wir das
Werk - Genfer Streifen, eine Feinvergoldung für Federhaus- und
,Räderwerksbrücke und gebläute oder schwarz geschliffene Schrauben." Durch
den Sichtboden wird dann später jeder unsere uhrmacherische
Kunstfertigkeit bewundern - und wir können ganz dezent angeben: „Och, das ...
sowas mach ich immer selber."
Also
ran an den Werkzeug-Satz, alles mal befummeln, und los. Ich sitze neben Horst,
einem Braumeister aus der Duisburger Gegend.
Wir helfen uns, so gut er kann. Zum ersten Mal in meinem Leben zerlege ich eine
Uhr und kann sogar hoffen, hinterher nicht noch ein paar Teile übrig zu haben,
wie bei meinen Rasenmäher-Reparaturen. „Hast du das mit dem Abspannen der Feder
begriffen?", frage ich den Bier-Experten. Er zeigt mir den Trick mit dem
Ausklinken des Gesperrs, und „Rrrrt" surrt
sich die Mechanik in Ruhelage. Nach der anfänglichen Nervosität beim Anblick
von Fliegendreckkleinen Schrauben und dem Herumkriechen auf dem Boden auf der
Suche nach denselben, geben erste Erfolge Sicherheit. Ankerkloben,
Hemmungsrad, Anker - . alles alleine geschafft. Am Ende des ersten Seminartags,
als wir uns bei einem Glas Bier gegenseitig auf die Schulter klopfen, tickt
meine Uhr tatsächlich wieder.
Der nächste Morgen, der Kaffee, die Suche nach
Erklärungen: Warum machen Männer sowas? Warum sitzen wir stundenlang auf
unbequemen Uhrmacher-Hockern an unbequemen Uhrmachertischen und arbeiten
hochkonzentriert und ohne Bezahlung, bis uns die Finger zittern? Ich für meinen
Teil glaube ja, es hängt irgendwie mit diesem Märklin-Baukasten zusammen, den ich
mir mit neun oder zehn sogar noch sehnlicher gewünscht habe als das Bonanza-Rad
mit Bananensattel. : Beides habe ich nie bekommen. Ob meine Mit-Bastler einst
ebenso vergeblich auf ihre Baukästen hofften, erfahre ich nicht. Sie
verschließen sich derart psychoanalytischen Deutungsansätzen und sagen dafür
Sätze wie Uwe, der Immobilienhändler aus dem Westfälischen: „Die Liebe zum
Mechanischen, die Möglichkeit, von Till und Franz in die Geheimnisse der
Uhrmacherkunst eingeführt zu werden, Dinge zu lernen, die die Meister sonst nie
preisgeben", das habe ihn hierher geführt. Und dann nicken alle noch mal
andächtig, bevor wir mit der Feinveredelung beginnen:
„Sanft", sagt Franz, „ganz langsam drehen,
ganz sachte andrücken", schließlich seien das Genfer Streifen und keine
Riefen-Profile in Straßenbahnschienen. Fast zärtlich senkt sich der Schleifkopf
auf die Brücken, ein wunderbares Muster, und er muss mir
kaum helfen„dabei. „Gut gemacht", würdigt
Till die Ergebnisse unserer Co-Produktion. Nach so viel Aufmunterung beschließe
ich in einem Anfall von Übermut, meine Schrauben nach alter Glashütter
Tradition nicht zu bläuen, sondern schwarz zu schleifen. Diese feinste Art der
Dekoration ist, wie alle Veredelungsarbeiten, technisch ganz und gar nutzlos -
doch Uhrenfreunde können sich daran nicht satt sehen.
Nach vier Stunden, in denen wir die Brücken kurz
ins galvanische Gold-Bad gesenkt, sie geschliffen, geschrubbt und geschraubt
haben, streifen wir uns die wurstpellenartigen Fingerlinge über. Kein Stäubchen
darf jetzt mehr aufs Schräubchen, jeder winzige Ausrutscher mit dem Werkzeug
hinterlässt bleibende Eindrücke, und wer seine blitzsaubere Schönheit mit
fettigen Pfoten angrabscht, muss für alle Zeit mit dieser Art von
„Digital"-Uhr leben. Ich drehe noch kurz einer Werkhalteschraube den
Kragen ab. „Wie hast du das denn geschafft?", fragt Till, und ich wage
einen verzweifelten Scherz: „Pass auf, ich zeig's dir, das ist ganz
einfach." Alle lachen. Aber nur, bis Till meine Uhr als letzte - Sie
wissen schon: wegen der Brille - auf die Zeitwaage legt. „Deine geht am
genauesten", mittlere Gangabweichungen, die den Vergleich mit Olivers
Protz-Rolex standhalten. Nur, dass meine Uhr viel schöner ist. ,
Findet übrigens auch meine Frau. „Sieht gut
aus", sagt sie, als ich ihr mein „Meisterwerk" voller Stolz von allen
Seiten vorführe: „Schau nur Schatz: die Roger Scholl Nummer Eins`, meine
allererste Selbstgebaute." Als sie diese drei letzten Worte hört, guckt
sie für einen Augenblick so, als wolle sie mir zu Weihnachten einen
Märklin-Baukasten schenken.
|